Wir alle kennen Prüfungen. Das Leben stellt uns solche und vor allem erinnern wir uns an Schulprüfungen. Das löst angenehme oder unangenehme Gefühle aus. Bewegend ist es sicherlich.
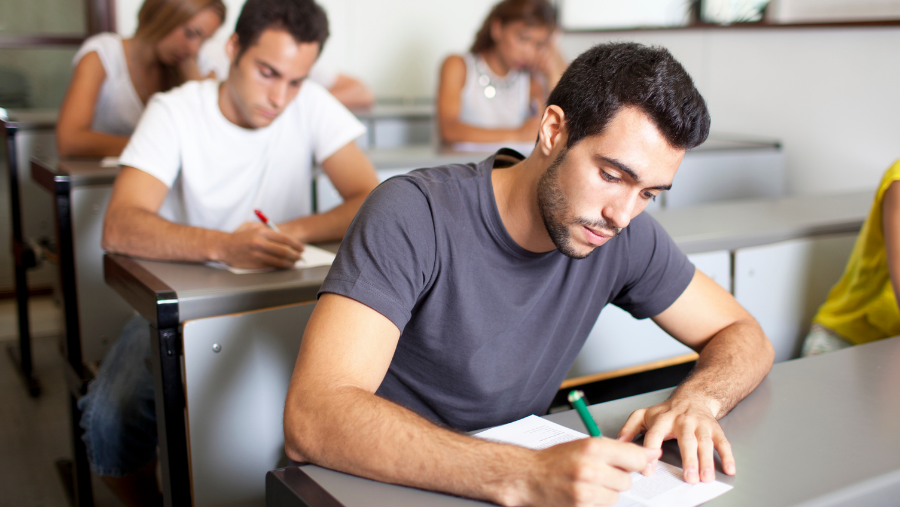
Was sind faire Prüfungen?
Doch was sagt uns ein Prüfungsergebnis, eine Note? Ist es der Beweis für Lernerfolg? Zeigt es dem künftigen Arbeitgeber Praxiserfolg an? Oder dem Dozenten bzw. der Schule, dass wirksam unterrichtet wurde? Oder gar der Gesellschaft, dass sie die finanziellen Mittel in die Ressource Humankapital sinnvoll investiert hat?
Prüfungen werden somit dann sinnvoll, wenn sie vorstehende Fragen beantworten. Jede Anspruchsgruppe (Student, Dozent, Bildungsgangverantwortlicher, Schule, Arbeitgeber, Gesellschaft…) hat unterschiedliche Vorstellungen von einer fairen Prüfung. Dazu kommt noch, dass Prüfungen während der Ausbildung (sogenannte formative Prüfungen während der Lernphase) anderen Anforderungen genügen müssen, als Prüfungen am Schluss der Ausbildung (sogenannte summative Prüfungen).
Welche Attribute müssen Prüfungen erfüllen?
Sinnvoll sind aus wissenschaftlicher Sicht Prüfungen dann, wenn sie folgenden Attributen genügen:
Validität: Der Test misst das, was er zu messen vor-gibt. Daher ist die Kompetenz klar zu formulieren.
Ein häufiges Problem ist, dass der Test statt des Fach-inhalts, die Deutschkompetenz misst (durch komplexe Fragen und anspruchsvolle Freitextfragen).
Reliabilität: Zuverlässigkeit/Genauigkeit der Messung, d. h. mehrfach durchgeführte Tests hintereinander erge-ben jeweils das gleiche Resultat. Es darf damit keine Gewöhnung geben.
Objektivität: Unabhängig vom Experten oder den Durchführungsbedingungen ergibt es das gleiche Resul-tat – gerade in mündlichen Prüfung.
Trennschärfe: Es gibt eine sinnvolle Streuung zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Personen (im Sinne der Normalverteilung nach Frederic Gauss).
Schwierigkeit: Die Aufgabe soll für einen Grossteil der Personen lösbar sein.
Ökonomie: Wirtschaftliche Durchführung der Prüfung. Gerade elektronische Prüfungen punkten hier, da Fra-gen aus dem Fragepot mehrfach nutzbar sind und die Auswertung auf Knopfdruck erfolgt.
Einbettung: Sinnvolle Einbettung in den Lehr-/Lernkontext als Zwischen- oder Schlussprüfung.
Akzeptanz: Die Prüfung soll für die Absolvierenden so-wie die übrigen Beteiligten als fair und idealerweise gar als attraktiv wahrgenommen werden und von ihnen ak-zeptiert sein.
Testmöglichkeiten an Muster- oder Vorjahresprüfungen geben Sicherheit und stellen sicher, dass die Kandidatinnen und Kandidaten die Technik sicher im Griff haben.
Selbstcheck und Fremdevaluation der erstellten Prüfungen
Wie weit die Testkriterien erfüllt sind, gilt es immer wieder zu prüfen. Durch einen kritischen Selbstcheck, aber auch durch eine Fremdevaluation. Durch die Studierenden mit einer Befragung sowie durch Erhebung bei den übrigen Stakeholdern. Und es sind, wie vorgängig bei den Testkriterien dargestellt, Zielkonflikte. Ein Evaluationskonzept stellt das sicher.
Es ist somit eine äusserst anspruchsvolle Aufgabe, eine Prüfung zu konzipieren und anschliessend darauf abgestützte Fragen zu stellen. Im Rahmen der Prüfungskonzeption wird festgelegt, welcher Inhalt respektive Prüfungsgegenstand genommen wird und welchen (kognitiven) Handlungen er gegenübergestellt wird. Damit stellt man sicher, dass die verschiedenen Gebiete angemessen in der Prüfung vertreten sind und die Komplexität (Taxonomiestufe) angemessen verteilt ist. Basis für „was man fragen darf“ sind vielfach Reglemente und Wegleitungen.
Und erst jetzt erfasst man die Fragen gemäss dem erstellten Konzept. Diese prüfen nun, was es zu prüfen gilt. Im Blogbeitrag Online-Prüfungen erstellen und durchführen gehe ich vertieft darauf ein.
Über den Autor:
Jürg Studer, war langjähriger HRM-/HRD-Verantwortlicher. Heute ist er Inhaber des Fachverlages SPEKTRAmedia und Dozent an mehreren Fach(hoch)schulen sowie Präsident des VPA, dem Verband der Personal- und Ausbildungsfachleute. Auch bei EducAvanti hat Jürg Studer ein Dozentenmandat inne.